Im Interview: Sophie Hunger, Sängerin
Interview: Mathias Morgenthaler/Foto: Marikel Lahana
Nach 150 Konzerten und 200 Reisetagen in einem Jahr hat Sophie Hunger Ende 2013 ihre Zelte abgebrochen und das Weite gesucht. 16 Monate später ist sie zurück mit dem Album «Supermoon» und bricht zu einer weiteren Tournee auf. Im Interview erzählt sie über die selbst gewählte Heimatlosigkeit, magische Momente auf der Bühne, ihr intimes Verhältnis zu Roger Federer und über die Liebe, die sie dummes Zeug erzählen lässt.
Hinter Ihnen liegt ein zweitätiger Interviewmarathon. Das heisst auch: Sie haben zwei Tage lang gegen ihre eigene Regel verstossen, ein Künstler habe weder sich selber noch sein Werk zu erklären.
SOPHIE HUNGER: Nein, das stimmt nicht. Ich habe es geschafft, zwei Tage lang viel zu reden und nichts zu sagen. Das fällt mir leicht, denn ich bin nicht sehr kompetent darin, mich oder mein Werk zu erklären. Mein Geschäft ist Musik, nicht Analyse.
Dabei gäbe es so schöne Geschichten zu erzählen. Wie Sie sich dem ganzen Musikbetrieb einfach entzogen haben Ende 2013. Wie war das, 16 Monate lang nicht aufzutreten?
Es war ein starker Einschnitt. So lange habe ich noch nie Pause gemacht. Davor war ich sechs Jahre lang praktisch permanent auf Tour mit meiner Band. Speziell intensiv war die Auszeit, wenn ich Konzerte anderer besuchte. Du kaufst ein Ticket, gehst hin, holst dir etwas zu trinken, suchst einen Platz mit Blick auf die Bühne… dann wird es plötzlich dunkel, du wirst nervös für die Musiker, die da rauskommen, spürst, wie zerbrechlich das alles ist, leidest mit, hoffst, dass der Funke überspringt aufs Publikum, bekommst Schweissausbrüche, wenn die Gitarre ausfällt oder nur wenige klatschen. Manchmal schaute ich staunend zu und dachte: Man muss schon ein wenig verrückt sein, um sich das anzutun.
Im Jahr 2013 kamen Sie auf 150 Konzerte und 200 Reisetage. Wann haben Sie gemerkt, dass es zu viel wird?
Das zeigt sich an scheinbar Nebensächlichem. Einmal machte ich mich in meiner Zürcher Wohnung parat und bemerkte, dass ich meine Schuhe nicht anziehen konnte. Das ist ja normalerweise keine schwierige Aufgabe, ich habe das ganz gut im Griff, aber an diesem Tag schaffte ich es einfach nicht, in die verdammten Schuhe reinzukommen. Es endete damit, dass ich sie aus dem Fenster schmiss und dachte: Irgendetwas ist nicht mehr wie vorher.
Das war Ende 2013?
Ja. Wir spielten in Zürich unser letztes Konzert, ein sehr gutes Konzert. Wir Musiker schlossen uns nach dem letzten Lied im Backstage-Bereich ein, um unter uns zu sein. Ich sah, dass alle anderen Bandmitglieder weinten. Ich schaute sie an, wunderte mich zuerst über ihre Tränen und dann über mich, wie distanziert ich war am Ende dieser langen Tournee. Ich war mehr Zuschauerin als Teil der Band.
Und da war Ihnen klar, dass Sie die Notbremse ziehen müssen?
Da fällte ich den egoistischen Entscheid, die Termine für 2014 abzusagen und nach Kalifornien zu ziehen. Ich checkte keine Mails, lebte in Wohnungen anderer Leute, die ich über Airbnb mietete. Das war eine grosse Befreiung, nichts und niemand sein zu müssen, fremd zu sein, ein unbeschriebenes Blatt. Da ich an Orten lebte, wo viele andere auch fremd waren – erst in San Francisco, dann Los Angeles und Mexiko – ergaben sich leicht neue Kontakte. Mit der Musik blieb ich die ganze Zeit in Verbindung. Ich achtete auch bei der Wohnungsmiete darauf, dass es immer Instrumente um mich hat.
Sie wollten also nur der Bühne entkommen, nicht der Musik.
Ja, ohne Musik geht es nicht, das ist meine Form des Existierens. Am 2. Januar, keine Woche nach meiner Ankunft in San Francisco, kaufte ich mir eine Gitarre. Mit Mütze und Schal sass ich in der schlecht isolierten Surferwohnung und begann wieder zu spielen. Dann zog ich auf die andere Seite der Golden Gate Bridge und ging regelmässig in eine Bar, um die Australian Open zu sehen. Es war eine aufregende Zeit für einen Schweizer Tennis Fan, Federer erreichte die Halbfinals, Wawrinka gewann das Turnier. Eines Abends, als ich dort Tennis schaute, tauchte der Musiker Tony Molina in der Bar auf, mit einem Stapel Platten unter dem Arm und seinem Bassisten im Schlepptau. Wir kamen ins Gespräch über Musik, und als ich sagte, ich sei aus Zürich, erzählten sie mir voller Begeisterung von Zürcher Punk Bands der Achtzigerjahre. Da gehst du endlos weit weg und in einer Bar erzählen dir Leute Insidergeschichten aus der Zürcher Musikszene.
Und schon waren Sie wieder mittendrin im Musikbusiness.
Ja, die beiden nahmen mich mit nach Hause, zeigten mir ihre Plattensammlung, nahmen mich mit in ein Tonstudio. Dort lernte ich John Vanderslice kennen, und bald darauf entstand der Titelsong meines neuen Albums: Supermoon. Später in Mexiko lernte ich auf ähnliche Art und Weise viele Leute kennen, alles sehr zufällig. Manche davon sind in den Videoclips zu Supermoon zu sehen.
Wo immer Sophie Hunger hingeht, entsteht Kunst?
Ich glaube, ich bin eine simple Person: Ich nehme das auf, was um mich herum passiert, bringe es in eine Form, eine Melodie, einen Text. Ich brauche Gegenstände im Aussen, um mich auszudrücken. Andere können das aus sich schöpfen, für mich geht es nicht ohne den Umweg. So wenig ich über mich weiss, so gut kann ich mich in andere versetzen oder mir Dinge vorstellen. Irgendwann wird die Imagination dann stärker als die Realität.
Gilt das auch für Ihr Verhältnis zu Roger Federer?
Ja, das ist extrem. Ich fühle mich so stark mit ihm verbunden, dass ich grausam leide bei seinen Spielen. Ich schaue jeden Match von ihm, nicht nur die Finals. Es ist auch schon vorgekommen, dass ich deswegen an einem Konzert nicht in bester Verfassung war. Ich habe eine sehr enge Beziehung zu ihm, obwohl ich ihm nie begegnet bin und das auch gar nicht möchte. Oft träume ich von ihm. Nichts Romantisches, wir sind zusammen im Taxi oder in der Umkleidekabine kurz vor einem wichtigen Match. Ich spüre Federers Unsicherheit und versuche, ihm mit Worten zu vermitteln, dass er der Beste ist.
Was sagt dann Sophie Hunger als Coach zu Roger Federer?
Meistens sage ich ihm: «Die Unterschiede sind minim, eigentlich gibt es sie gar nicht. Niemand ist besser als du. Befreie dich von dieser Vorstellung.» Ok, manchmal sage ich ihm auch, er solle versuchen, seine Rückhand öfter zu umlaufen – solche Sachen.
Woher kommt diese Verbundenheit?
Federer ist so rein. Er hat eine so direkte Verbindung mit seinem Sport. Sein Talent ist identisch mit seiner Spiellust. Sein Tennis verkörpert für mich Perfektion, ein Schönheitsideal. Ich habe ihn zwei Mal live erlebt, in Genf im Davis Cup und drei Jahre zuvor in Roland Garros. Diese Eleganz, mit der er Bälle zurückspielt, die mit über 200 km/h auf ihn zufliegen, das ist Kunst in meinen Augen, grosse, berührende Kunst.
Sie kehren am Mittwoch nach 16 Monaten Abwesenheit auch wieder auf die Bühne zurück. Haben Sie diese Momente vermisst?
Ich bin dann am Lebendigsten, wenn ich Musik machen kann. Ich geniesse es schon in einem Zimmer oder im Studio, wo die Songs weiterentwickelt werden. Durch das Publikum kommt eine weitere Dimension dazu. Da gibt es manchmal diese magischen Momente, dieses Aufgehen im Augenblick. Es ist dann wie ein Tanz mit dem Publikum.
Aber Sie sind die Regisseurin.
Nein, am besten ist es, wenn ich mich und die Situation vergesse. Sobald ich mich während eines Konzerts in Betracht ziehe, bin ich eingeschränkt, tauchen Ängste auf. Wenn ich mir zuschaue, bin ich gespalten, nicht mehr ganz in der Musik. Was zwischen mir und dem Publikum entsteht, diese Momente der Intimität, lässt sich nicht steuern. Die Stille etwa, die so eindrücklich sein kann, die kann ich nicht befehlen, die kommt aus dem Publikum.
Wie wird das sein, nach 16 Monaten wieder aufzutreten? Sie sagten einmal, es gebe vor jedem Konzert einen Moment, in dem es für Sie unvorstellbar sei, gleich auf die Bühne zu gehen und zu singen.
Das wird für mich selber eine Überraschung sein. Es gab einen kleinen Vorgeschmack, als ich kürzlich in einer Fernsehsendung auftrat und ein Lied spielen musste. Da erlebte ich zum ersten Mal wieder diesen Countdown vor einem Auftritt. Es ist schon krass, was da im Körper passiert, all das Adrenalin, diese Wachheit an der Grenze zum Durchdrehen – ich hatte das völlig vergessen. Nach dem Lied fragte ich meinen Agenten entgeistert, wie ich 90 Minuten in diesem Zustand durchhalten soll auf der Tournee.
Sie haben Ihre Wohnung in Zürich verlassen, leben mehrheitlich in Berlin, sind aber nirgendwo mehr zuhause, wie Sie selber sagen. Was ändert sich dadurch?
Ich bin jetzt richtig entwurzelt und das ist ein ganz gutes Gefühl. Oder sagen wir es so: Ich möchte, dass es gut ist, aber ich weiss es noch nicht. Wer nur mit zwei Koffern unterwegs ist und kein Zuhause mehr hat, um das er sich kümmern muss, ist frei und leicht.
War das ein bewusster Entscheid, zu allem noch mehr auf Distanz zu gehen, möglichst ungebunden zu leben?
Nein, am Anfang war es ein praktisches Problem. Das Haus, in dem ich in Zürich vier Jahre sehr günstig gelebt und gearbeitet hatte, wurde verkauft. Die neuen Besitzer warfen uns prompt raus. Das hat mich getroffen – ich habe seither Angst, einen Fuss in den Kreis 5 zu setzen, es tut noch weh. Ich wohnte dort mit meinem Bruder, hatte viele Leute beherbergt, hatte mein Studio, kannte die Kinder im Hof. Das Haus hat mich immer beschützt. Wenn ich lange auf Tournee war, gab mir der Gedanke ans Zurückkehren Kraft. Ich träume noch immer mindestens zweimal pro Woche davon; im Traum wandle ich durchs Haus und versuche nicht entdeckt zu werden, wie ein Geist.
Und da sagten Sie sich: Besser keine Wurzeln mehr schlagen als noch einmal entwurzelt werden?
Ich habe mir das nie überlegt, aber vielleicht war das wirklich so. Heute kannst du mich überall rausschmeissen, jetzt ist es mir egal. Es stimmt auch nicht, dass Berlin mein neuer Lebensmittelpunkt ist, ich bin keine 100 Tage im Jahr dort. Ich bin eine Fahrende und versuche, dort zuhause zu sein, wo ich gerade bin.
«I am empty but I’m never alone», singen Sie im Titelstück Supermoon. Trifft das Ihr Lebensgefühl?
Leer und unbewohnt zu sein hat den Vorteil, dass man viele Eindrücke aufnehmen kann. Ich brauchte immer eine grosse Portion Unrast, um produktiv sein zu können. Das Uninteressanteste wäre für mich vermutlich, ausgeglichen zu sein. Zudem hat es praktische Vorteile, nirgendwo sesshaft zu sein. Dann muss – wenn ich einmal sterbe – niemand meine Wohnung aufräumen, sich durch all den Mist kämpfen. Das möchte ich niemandem zumuten, die Bücher zu entsorgen, die Elektronik, all die Hosen und Schuhe.
Fände man nichts Persönliches bei Ihnen?
Nein, gar nichts. In Berlin übernachten immer mal wieder Leute bei mir, auch solche, die ich kaum kenne. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich irgendetwas wegräumen müsste, aber es gibt nichts Privates, das ich verstecken müsste. Auch wenig Persönliches, nur ein paar Bilder von meiner Familie.
Im Lied «Heicho» singen Sie, Sie kämen erst zum Sterben wieder nach Hause zurück. Erschrecken Ihre Eltern manchmal, wenn sie Ihre Lieder hören?
In diesem Fall gab es Tränen, ja, und ich musste ihnen ausführlich erklären, dass das nichts mit ihnen zu tun hat. Meine Lieder gehen über das Persönliche hinaus, auch wenn die Themen, über die ich singe, natürlich mit mir zu tun haben. Privates fliesst zwar in die Texte ein, aber das ist nicht relevant, denn private Zusammenhänge haben keine kommunikative Kraft, sie sind banal und komplett uninteressant. Es kommt darauf an, ob ich eine Sprache entwickeln kann in Wort und Ton, die Bedeutung hat über das Individuelle hinaus.
Was gibt Ihnen Halt?
Ich weiss es nicht und ich denke auch ungern darüber nach. Wenn ich mir diese Frage stellen würde, bekäme ich vermutlich grosse Angst. Deshalb weiche ich solchen Fragen aus, möchte die Antwort nicht kennen. Jedes Mal, wenn ich im Leben dachte, ich hätte etwas begriffen, gab es kurz darauf ein Ereignis, das alles auf den Kopf gestellt hat. Deswegen habe ich mir abgewöhnt, irgendwelche Gewissheiten zu haben. Ich mache meine Sachen und versuche, höflich zu sein. Verstehen soll das alles, wer will. Wenn Sie mir all diese Fragen stellen und mich in diesem Gespräch als entwurzelt und haltlos darstellen, dann klingt das allerdings ziemlich traurig.
Man könnte auch sagen: Sie knüpfen am Lebensstil Ihrer Kindheit an. Da wechselten Sie wegen des Diplomatenberufs Ihres Vaters so oft den Wohnort, dass es keinen Sinn machte, Freundschaften aufzubauen und Wurzeln zu schlagen.
Ja, da gibt es wirklich Parallelen. Und ich mag das sehr, unabhängig zu sein, unterwegs zu sein, viele neue Orte und Menschen zu sehen. Aber ohne ein paar Fixpunkte ginge es nicht. Ein ganz wichtiger ist zum Beispiel Patrick David, mein Manager, der seit Anfang an dabei ist. Ohne ihn würde ich das nicht schaffen. Meine Musiker und Techniker, die auch lange dabei sind, geben mir ebenfalls Sicherheit. Und auf eine seltsame Art gibt mir auch mein Publikum Halt, obwohl ich da ja niemanden persönlich kenne. Das Publikum schreibt mir eine Rolle zu – das ist auch eine Stütze.
In Ihren Regeln für das Leben als Künstlerin sagen Sie auch, man dürfe nicht gefallen wollen. Halten Sie diese Regel ein?
Naja, es gibt einen Bereich, in dem das unmöglich ist. Sobald romantische Gefühle im Spiel sind, ist man chancenlos. Deshalb lautete das Gebot ursprünglich: «Versuche nie zu gefallen – ausser du bist verliebt.» Den Zusatz mit der Liebe habe ich dann fallen lassen, weil ich das Wort nicht mag.
Der «Zeit» haben Sie vor drei Jahren gesagt, Sie verliebten sich eigentlich nie.
Die Zeiten ändern sich und wir uns mit ihnen. Weitere Fragen?
Schämen Sie sich immer noch, wenn irgendwo Ihre Musik läuft?
Ja, damit tue ich mich schwer. Vielleicht, weil mir dann bewusst wird, wie viel ich von mir preisgebe. Wenn ich auf die Bühne gehe, ist das jedes Mal wie ein Sprung ins Leere, ins Ungewisse. Daraus ergibt sich – wenn es gut läuft – eine Art Rausch, ich bin dann wie in Trance, in Verbindung mit der Energie des Publikums. Auf der Bühne lasse ich Intimität zu, in allen anderen Lebensbereichen ist sie mir unangenehm. Vielleicht erschrecke ich deshalb, wenn ich mich sehe oder höre. Vielleicht aber auch, weil ich mir bewusst werde, wie albern meine Tätigkeit eigentlich ist.
Albern?
Wir erfinden etwas Unsichtbares und die Leute kommen zum Konzert, weil sie an einer Illusion teilhaben möchten. Das kann man nicht allzu ernst nehmen, wenn man ehrlich ist. Es gäbe so viel Wichtigeres zu tun.
Was treibt Sie denn an, nun zur nächsten Tournee aufzubrechen?
Musik ist schlicht das einzige was ich kann und was mich für Momente glücklich macht. Manchmal macht mir das Angst, wie das weitergehen soll, nach jeder CD eine weitere zu machen. Ob ich das durchhalte. Aber das sind Luxussorgen. Die Strassenbauer und Müllmänner fragt niemand, was sie antreibt, ihren Job zu tun. Ich hatte sehr viel Glück in meinem Leben. Wenn ich morgen in einem Flugzeugabsturz umkäme, hätte ich nichts verpasst. Ich könnte heute nicht sagen, was ich mir anders, besser wünschen würde.
So euphorisch hört man Sie selten. Das muss die Liebe sein.
Gut möglich, so dummes Zeug habe ich wirklich noch nie erzählt.
Haben Sie gar keine Ziele mehr?
Doch, klar. Ich würde zum Beispiel gerne eine eigene Radiosendung haben. Als Kind machte ich leidenschaftlich Radio, einfach für mich. Mein Sender hiess «Radio 22210». Ich machte Informationssendungen, produzierte Werbespots, imitierte eingeladene Gäste wie Professoren und Politiker. Eine wichtige Rubrik bildeten die Dankesreden von Oscar-Preisträgern. Als Kind liebte ich es, mir solche Sachen auszudenken. Das hat sicher auch mit meinem Grossvater zu tun, der ein Radiopionier war. Nun habe ich bei Radio1 in Berlin wieder Radioluft geschnuppert. Ich hätte Lust, regelmässig interessante Leute in eine Sendung einzuladen.
Und als Musikerin?
Ich würde verdammt gerne den Mercury-Preis gewinnen, aber das ist nicht möglich, da ich keine Engländerin bin. Dann würde ich mich über einen Grammy freuen, was theoretisch möglich, aber sehr schwierig ist. Schliesslich möchte ich ein Visum, um in den USA arbeiten zu können für drei Jahre – nicht unmöglich, aber mühsam. Und ich hätte gerne eine super Plattenfirma in den USA, die zu mir passt und mir hilft auf diesem Markt. Ach und ich wäre gerne so schön wie Kate Moss und schriebe so gute Texte wie die australische Songwriterin Courtney Barnett… Mein grösster Traum ist aber ein ganz anderer.
Nämlich?
Dass Roger Federer nächstes Jahr in Rio Olympiasieger wird. Und zwar soll er im Halbfinal Djokovic schlagen, vernichtend in drei Sätzen, vor den Augen des serbischen Clans. Im Final muss er Nadal niederringen, ein letztes Drama, das jedem, der dort im Stadion ist, unter die Haut geht und unvergesslich bleibt.
Kontakt und weitere Informationen: www.sophiehunger.com
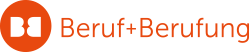
Weitere Interviews mit Querdenkern & Unternehmerinnen
auf www.beruf-berufung.ch

