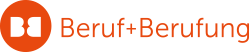Im Interview: Thomas Sattelberger, langjähriger Konzernmanager und Personalexperte
Interview: Mathias Morgenthaler/Foto: zvg
Durch seine Arbeit bei Daimler, Lufthansa, Continental und Deutsche Telekom erwarb sich Thomas Sattelberger den Ruf des mächtigsten Personalchefs Deutschlands. Aus Rücksicht auf seine Gesundheit beendete er vor drei Jahren die Konzernkarriere. Heute wundert sich der 66-Jährige, wie sehr die angeblich so selbstbewusste «Generation Y» auf Sicherheit und Stabilität setzt und wie wenig Mut sie an den Tag legt.
Herr Sattelberger, Sie galten bis zu Ihrem Abschied bei der Deutschen Telekom als mächtigster Personalmanager Deutschlands, waren aber auch bekannt dafür, bis zu 100 Stunden pro Woche zu arbeiten und an Wochenenden 130 Mails an ihre Untergebenen zu verschicken. Wie denken Sie mit etwas Abstand an diese Zeit zurück?
THOMAS SATTELBERGER: Ich habe in meinem Manager-Leben überwiegend Freude und Genuss empfunden. Das heisst nicht, dass mir alles Spass gemacht hat, aber ich konnte stets etwas bewirken und bewegen. Die meisten Leute werden ja nicht krank, weil sie zu viel arbeiten, sondern weil sie ihre Arbeit nicht als sinnvoll erleben und keinen Gestaltungsfreiraum mehr haben in der Konzernwelt. Da werden im Effizienzwahn Ertragsziele von der obersten bis auf die unterste Ebene weitergereicht, und gleichzeitig wundert sich das Management, dass es so wenig Innovation im Hause gibt. Wer im mentalen Gefängnis von Ziel- und Leistungsmanagement seine Sklavenarbeit verrichtet, wird keine neuen Ideen entwickeln.
Müssen Top-Manager ihre Untergebenen wirklich auch am Wochenende auf Trab halten?
Nein, kein Chef darf so in die freie Zeit seiner Mitarbeiter eingreifen. Ich habe das spät, aber nicht zu spät erkannt – die Deutsche Telekom hat sich 2010 als erstes Unternehmen die Verpflichtung auferlegt, dass Mitarbeiter in der Freizeit und am Wochenende keine Mails beantworten müssen.
Waren Sie nicht nicht trotzdem in einem Hamsterrad als Personalvorstand bei der Deutschen Telekom? Es heisst, Sie hätten Ihr Smartphone auch über Nacht nie ausgeschaltet.
In Krisenzeiten war das so. Die ständige Erreichbarkeit ist der Preis, den man bezahlt in solchen Jobs an der Unternehmensspitze. Ich habe das lange Zeit gut wegstecken können. Bei der Deutschen Telekom wurde es aber so extrem, dass ich die Notbremse ziehen musste. Die Transformation von der zentralisierten Beamten- zu einer dezentralen Servicekultur war enorm schwierig. Kaum war ich im Amt, gab es Massenstreiks gegen die Reorganisation, dann den Bespitzelungsskandal, die Call-Center-Schliessungen etc. – die Granaten schlugen quasi im Wochentakt ein und ich war für 240‘000 Angestellte verantwortlich. Für meine Kernanliegen, das Talentmanagement, die Diversity-Förderung und die Arbeitgeberattraktivität, blieb kaum noch Zeit.
Wann merkten Sie, dass es zu viel wurde?
Wenn der mobile Blutdruckmesser erratische Ausschläge zeigt und das Körpergewicht neue Rekordhöhen erreicht, kann man sich schlecht einreden, es sei alles in Ordnung. Deswegen entschied ich mich im Frühjahr 2010, die Deutsche Telekom zum Vertragsende 2012 zu verlassen und von da an meinen Terminkalender selber zu verwalten. Man bot mir noch einen Job im Silicon Valley als Personalchef eines IT-Giganten an, aber für mich war es an der Zeit, mit der Konzernkarriere abzuschliessen.
Täuscht der Eindruck oder arbeiten Sie heute ähnlich viel wie vorher?
Das Letzte, was ich suchte, war ein ruhiges Leben und Gelegenheiten zum Füsse hochlagern. Es gibt nichts, das uns stärker konstituiert und motiviert als sinnvolle Arbeit. Mir ist es im Kern immer darum gegangen, mir und anderen zu zeigen, was in mir steckt. Ich möchte mir am Ende des Lebens nicht vorwerfen müssen, meine Fähigkeiten vergeudet, mein Potenzial nicht ausgeschöpft zu haben. Deshalb arbeite ich auch heute als Non-For-Profit-Berater gerne und viel, keine 90 oder 100 Stunden mehr, aber 55 bis 60 schon. Ich bin allergisch auf dieses Work-Life-Balance-Gesäusel. Kein Mensch, der sich mit Herzblut für etwas einsetzt, ist immer schön in Balance. Und keiner, der seine Arbeit liebt, unterscheidet zwischen Arbeit und Leben.
Wenn junge Menschen Sie um einen Karriererat bitten, was antworten Sie dann?
Es wird ja viel Blödsinn über die angeblich so selbstbewusste und auf Selbstverwirklichung erpichte Generation Y geschrieben – vornehmlich von Beratern, die gutes Geld damit verdienen, den Unternehmen die Eigenheiten dieser seltsamen Generation zu erklären und ihnen Konzepte für die Personalgewinnung zu verkaufen. Ich halte das für einen Mythos. Was geben denn die Universitätsabsolventen bei Befragungen zu Protokoll? 40 Prozent suchen eine Stelle im öffentlichen Dienst, 20 Prozent wollen in einem Konzern arbeiten und 15 Prozent streben einen Job in staatsnahen Einrichtungen an. Sprich: Drei Viertel suchen in erster Linie nach Sicherheit und Stabilität im Beruf und Freiheit in der Lebensgestaltung. Weil diese jungen Leute teilweise sehr stromlinienförmig unterwegs sind, möchte ich wenigstens ein paar von ihnen dazu ermutigen, zu Beginn des Berufslebens vielfältige Erfahrungen zu erwerben. Wer das tut, kann sich später freier bewegen.
Also raten Sie von einer Konzernkarriere ab?
Grundsätzlich spricht nichts dagegen, sich in einem Konzern die ersten Sporen abzuverdienen. Das Problem ist, dass das Konzernleben süchtig respektive abhängig macht. Viele verpassen den Moment für den Absprung und erliegen den Verlockungen von Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das beeinträchtigt ihre persönliche Weiterentwicklung. Denn die Abstimmungs- und Koordinationsprozesse in Konzernen fressen unglaublich viel Zeit und kosten Nerven, die langwierigen Konsensrituale führen meist zu durchschnittlichen Ergebnissen. Ich blieb jeweils nur so lange in einer Organisation Konzern, wie ich dort unternehmerisch handeln konnte.
Bieten Konzernkarrieren die Sicherheit, welche die jungen Berufsleute suchen?
Nein, das ist ein Trugschluss. Wer glaubt, als abhängiger Angestellter die nächsten 30 Jahre in einem Konzern überleben zu können, wird ein böses Erwachen erleben. Von den 30 grössten börsenkotierten Unternehmen in Deutschland stecken mindestens 10 in schwerwiegenden Problemen – in der Schweiz dürfte es ähnlich aussehen. Disruptive Brüche und Innovationen gefährden die Geschäftsmodelle vieler Traditionsunternehmen; die Firmengrenzen werden durchlässig, rund die Hälfte der heutigen Jobs wird künftig von Computern verrichtet werden und nicht mehr von Menschen. Junge Berufsleute tun also gut daran, nicht auf einen vermeintlich starken Arbeitgeber zu setzen, sondern auf die eigenen Talente und die eigene Courage zu vertrauen und sich ein Portfolio an Erfahrungsfeldern aufzubauen. Am meisten lernt man bekanntlich nicht bei Sonnenschein, sondern im Sturm: bei Startups oder mittelständischen Unternehmen, die hart am Wind segeln.
Und die Grossunternehmen sind allesamt dem Untergang geweiht?
Nein, aber sie müssen demokratischer, agiler, dezentraler werden. Ich setze mich seit vielen Jahren für mehr Vielfalt und Demokratisierung in Konzernen ein. Was heute unter dem Stichwort Diversity getan wird, ist meist leeres Geschwätz und Schaufenstergestaltung. In den meisten grossen Unternehmen regieren ein paar ältere Männer über viele Angestellte, die sie als Produktionsfaktoren betrachten. Wers nicht glaubt, lese die Geschichten in Martin Suters Business-Class-Kolumnen nach. Die Digitalisierung bietet grosse Chancen für mehr demokratische Entscheidungen und bessere Innovationsprozesse. Entscheidend ist aber, ob sich die Unternehmenskultur ändert. Da sind die Schweiz und Deutschland nach wie vor Entwicklungsländer. Wenn wir nicht rasch dazulernen, drohen wir zur verlängerten Werksbank der grossen amerikanischen Softwaregiganten zu werden.